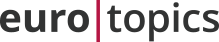In Nahost brodelt es nach wie vor: Die Gefechte zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah gehen weiter, Israels Kampf gegen die Hamas in Gaza ebenfalls. Kurz vor dem Wochenende hatte die sunnitische Terrormiliz Islamischer Staat (IS) den Anschlag mit mehr als 90 Toten im iranischen Kerman auf einer Gedenkfeier für Qassem Soleimani für sich reklamiert. Nun warnte US-Außenminister Antony Blinken vor einer Eskalation in der Region.
Die Präsidentin der renommierten US-Elite-Universität Harvard, Claudine Gay, ist nach heftiger Kritik zurückgetreten. Ihr wurde vorgeworfen, sich nicht ausreichend von antisemitischen Haltungen distanziert und in Publikationen plagiiert zu haben. Sie hatte in einer Kongressanhörung auf die Frage, ob ein Aufruf zum Völkermord an Juden gegen Uniregeln verstoße, geantwortet, es komme auf den Kontext an.
Der Streit in Polen um politische Methoden und die Neuausrichtung von Medien dauert an, nachdem die Regierung im Dezember die Führungsriege des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ausgetauscht hat. Zahlreiche Mitarbeiter und Zuschauer des ehemals PiS-treuen Senders TVP sind zum bisherigen Nischensender Telewizja Republika abgewandert. Dieser Aspekt der Transformation nach dem Regierungswechsel wird in den Medien lebhaft diskutiert.
Die libanesische Hisbollah-Miliz hat Israel für die Tötung des Hamas-Anführers Saleh Al-Aruri mit einem Drohnenangriff auf einen Vorort von Beirut verantwortlich gemacht. Der Anschlag werde nicht ohne Antwort bleiben, erklärte Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah. Von israelischer Seite gab es keine Bestätigung. Kommentatoren fragen sich, ob nun ein Flächenbrand in der Region droht.
Zum Superwahljahr 2024 gehört auch die US-Präsidentschaftswahl im November. Mit besonderer Spannung wird erwartet, wer für die Republikaner antritt. In den parteiinternen Umfragen zu den Vorwahlen, die am 15. Januar beginnen, liegt Ex-Präsident Donald Trump klar vorn. Aufgrund der vielen laufenden Verfahren gegen ihn ist seine Kandidatur aber nicht gesetzt.
Weltweit wachsende Ungleichheit, Klimakrise, Kriege in der Ukraine und Nahost sowie - fast vergessen - in Jemen und Sudan, der Zuwachs antidemokratischer Kräfte: die Liste der aktuellen Krisen und Kriege ist lang, Lösungen kaum in Sicht. Anlass für Kommentatoren, sich zu fragen, ob die Ära internationaler Bemühungen um Frieden und Gerechtigkeit 2024 endgültig vorbei ist.
Tschechiens Präsident Petr Pavel hat in seiner Neujahrsrede konkrete Schritte zur Einführung des Euro in seinem Land verlangt. Tschechien hatte sich mit dem Beitritt zur EU 2004 zum Euro bekannt, doch laut einer aktuellen Umfrage lehnen 63 Prozent der Bevölkerung die Gemeinschaftswährung ab. Das Für und Wider spiegelt sich auch in der Landespresse.
Auch im neuen Jahr hat Israel seine Offensive gegen die radikal-islamische Hamas im Gazastreifen fortgesetzt. Zudem gab es israelische Drohnen-Angriffe auf den Libanon – nach Armeeangaben als Reaktion auf Beschuss von dort – und den Vorwurf der gezielten Tötung eines Hamas-Anführers in Beirut. Kommentatoren warnen vor einer ausweglosen Lage.
Das Oberste Gericht Israels hat ein Kernelement der umstrittenen Justizreform von Benjamin Netanjahus Regierung gekippt. 8 von 15 Richtern stimmten gegen die Gesetzesänderung zur sogenannten Angemessenheitsklausel vom Juli 2023. Das Oberste Gericht verlöre mit ihr die Möglichkeit, Regierungsentscheidungen als "unangemessen" einzustufen und außer Kraft zu setzen. Ist Israels Demokratie nun wieder im Lot?
Österreichs Vorschlag hat sich in Brüssel durchgesetzt: Ende März 2024 werden die Personenkontrollen im innereuropäischen Verkehr mit Rumänien und Bulgarien abgeschafft – aber nur an Flughäfen und Seegrenzen. Die beiden Länder sollen nun mehr für den Schutz der EU-Außengrenzen tun und erhalten dafür zusätzliche Mittel. Ein akzeptabler Zwischenschritt auf dem Weg zu einem Schengen-Vollbeitritt?