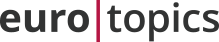Eine von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner eingesetzte Expertenkommission fordert in ihrem Abschlussbericht längere Dienstzeiten für Wehrpflichtige. Der Militärdienst in Österreich ist mit bisher sechs Monaten der kürzeste in ganz Europa. Unter drei ausgearbeiteten Modellen empfiehlt die Kommission acht Monate Grundwehrdienst plus zwei Monate spätere Übungseinheiten – entscheiden muss die Politik.
12 Debatten