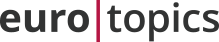Israel hat die internationale "Global Sumud Flotilla", die Hilfsgüter in den blockierten Gazastreifen bringen wollte, weit vor der Küste abgefangen und die 40 Schiffe und Boote aufgebracht. Von den 462 Personen an Bord befinden sich momentan noch mehr als 300 in israelischer Haft. Israel bezeichnete die Aktion als Provokation und schiebt die Aktivisten nun nach und nach ab.
In Marokko kommt es landesweit seit Tagen zu Protesten, vor allem von jungen Menschen. Anfangs verliefen sie friedlich, doch inzwischen gibt es Ausschreitungen und Polizeigewalt. Drei Menschen sind bereits umgekommen, hunderte wurden verletzt und verhaftet. Die Demonstranten fordern Investitionen in das Bildungs- und Gesundheitswesen statt in die Infrastruktur zur Ausrichtung der Fußballweltmeisterschaft 2030.
In Kopenhagen haben die EU-Staats- und Regierungschefs bei einem informellen Gipfel unter anderem über die Grundzüge eines von der EU-Kommission vorgeschlagenen "Drohnenwalls" gesprochen. Zahlreiche Luftraumverletzungen – vor allem beim Gastgeber Dänemark – hatten in jüngster Zeit die Dringlichkeit geeigneter Schutzmaßnahmen gegen Drohnen offensichtlich gemacht. Europas Presse diskutiert Prioritäten und Probleme einer gemeinsamen Abwehr.
US-Präsident Trump hat einen 20 Punkte umfassenden Plan zur Beendigung des Gaza-Krieges vorgelegt – und Israels Premierminister Netanjahu hat ihn akzeptiert. Die Zustimmung der an der Ausarbeitung des Plans nicht beteiligten Hamas steht jedoch aus. Die Terrororganisation soll dem Plan zufolge alle Geiseln freilassen und die Waffen niederlegen. Im Gegenzug soll sich Israels Armee zurückziehen. Die Medien erörtern, ob sich so der Krieg beenden lässt.
Weil sich der Kongress nicht auf ein Budget für das Steuerjahr 2026 einigen konnte, das am 1. Oktober begann, bleiben viele US-Behörden bis auf Weiteres geschlossen. Zuletzt waren am Mittwoch im Senat je ein Vorschlag der Republikaner und der Demokraten an der erforderlichen Drei-Fünftel-Mehrheit gescheitert. Zentraler Streitpunkt ist die Rücknahme von Kürzungen bei der Gesundheitsvorsorge für Geringverdienende.
Die konservative Minderheitsregierung unter Premier Luís Montenegro hat mit den Stimmen der rechtspopulistischen Chega von André Ventura ein neues Migrationsgesetz verabschiedet, das unter anderem den Familiennachzug deutlich einschränken soll. Kurz vor der anstehenden Kommunalwahl debattiert die Landespresse Gründe und mögliche Folgen dieser Kooperation.
Der britische Premier Keir Starmer hat auf dem Labour-Parteitag am Dienstag in Liverpool die Mitglieder auf einen klaren Regierungskurs eingeschworen. Im Zentrum standen wirtschaftliche Erneuerung, soziale Reformen – und eine scharfe Abgrenzung zur rechtspopulistischen Reform UK unter Nigel Farage, die in Umfragen bereits weit vor Labour liegt. Kommentatoren ordnen ein.
In der Republik Moldau hat die pro-europäische Regierungspartei PAS um Präsidentin Maia Sandu die Parlamentswahl mit 50,2 Prozent gewonnen. Der russlandfreundliche Patriotische Block des früheren Staatschefs Igor Dodon kam auf 24,2 Prozent. Trotz leichter Verluste kann die PAS damit ohne Koalitionspartner den Weg des Landes in Richtung eines EU-Beitritts fortsetzen. Europas Medien beleuchten das Ergebnis.
Am Freitag und Samstag wird in Tschechien ein neues Parlament gewählt. In den Umfragen führt die populistische Partei des ehemaligen Regierungschefs Andrej Babiš (ANO) mit rund zehn Prozentpunkten vor der liberal-konservativen Regierungskoalition von Premier Petr Fiala. Kommentatoren beobachten eine besonders angespannte Stimmung und analysieren die Gründe.
In Dänemark und Norwegen wurden am Wochenende erneut Drohnen unbekannter Herkunft in der Nähe von Flughäfen und Militärbasen gesichtet. Die dänische Regierung erließ als Reaktion ein bis Freitag geltendes Flugverbot für zivile Drohnen und Modellflugzeuge – auch, weil in Kopenhagen Mitte der Woche ein EU-Gipfel stattfindet. Die Medien erörtern, wie Europa auf diese und andere hybride Herausforderungen seiner Sicherheit reagieren soll.
In einem Prozess um mögliche illegale Wahlkampffinanzierung hat ein Gericht den ehemaligen französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy in Teilen für schuldig erklärt und zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt. Er habe enge Mitarbeiter mit dem Ziel handeln lassen, seinem Wahlkampf von 2007 finanzielle Unterstützung des libyschen Ex-Machthabers Muammar al-Gaddafi zukommen zu lassen. Kommentatoren ordnen ein.