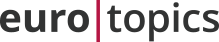EU-Klimaplan bis 2040: Ambitioniert oder kraftlos?
Die EU-Kommission strebt ein neues Klimaschutzziel an: Bis zum Jahr 2040 sollen mindestens 90 Prozent weniger CO2 ausgestoßen werden als 1990. Ab 2036 sollen Mitgliedsstaaten bis zu drei Prozentpunkte des Einsparungsziels durch Gutschriften aus Umweltprojekten in Ländern außerhalb der EU einkaufen können. Insbesondere diese Emissionszertifikate sorgen in Europas Presse für Diskussionsstoff.
Bilanztricks helfen nicht weiter
Für die taz droht durch die Gutschriften eine Verwässerung der Klimaziele:
„Am Ende stehen Klimaschutzerfolge auf dem Papier, die es in der Realität nicht gibt. Für die europäischen Behörden ist es schwierig, bei Klimaschutzprojekten am anderen Ende der Welt sicher zu überprüfen, ob sie halten, was sie versprechen. Selbst wenn sie gut arbeiten, ist oft unklar, ob sie nicht auch ohne die Zahlung aus Europa stattgefunden hätten. ... Der Knackpunkt ist: Die gesamte Welt muss schnell klimaneutral werden, wenn die Menschheit weiter genug Lebensraum auf der Erde haben will. Rechenspielchen und Bilanztricks verzögern das.“
Hauptsache, die Gesamtrechnung stimmt
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung begrüßt das eingebaute Schlupfloch:
„Das hilft dem Klima, dem es egal ist, wo CO2 reduziert wird. Und es hilft den EU-Staaten, weil der Abbau von CO2 außerhalb Europas meist billiger ist. Das nimmt Druck von der Wirtschaft und fördert die Akzeptanz der Klimapolitik. Nur weil solche Projekte vor zig Jahren in der Anfangszeit des Klimaschutzes nicht funktioniert haben, darf die EU nicht darauf verzichten. Sie kann und muss aber sicherstellen, dass die Projekte tatsächlich CO2 senken. Dann dürfen gerne auch mehr als drei Prozentpunkte angerechnet werden.“
Positiver Trend – auch ohne Auslagerung
Dagens Nyheter sieht die Emissionsgutschriften skeptisch:
„In einer Metastudie in Nature wurden 2.346 solcher Projekte analysiert. Das Ergebnis war, dass weniger als 16 Prozent der Emissionsgutschriften einer tatsächlichen Emissionsminderung entsprachen. ... Angesichts des zunehmenden Widerstands gegen den Klimawandel – Ungarn, Polen und Frankreich haben sich bereits gegen das Ziel für 2040 ausgesprochen – ist es erleichternd, dass die Europäische Kommission ihre Ambitionen nicht noch weiter zurückgeschraubt hat. Die Klimapolitik der EU war bislang ein großer Erfolg. ... Dies gibt Anlass zur Hoffnung, dass die Emissionen weiter sinken können, sodass die EU ihre Ziele erreichen kann – auch ohne die Nutzung von Emissionsgutschriften.“
Deutschland verwässert die Ziele
Avvenire befürchtet Augenwischerei:
„Die Kritik vieler Nichtregierungsorganisationen und Experten betrifft in erster Linie einen entschieden neuen Punkt. Nämlich die Möglichkeit, bis zu maximal drei Prozent von den CO2-Reduktionsverpflichtungen abzuziehen, von der Kommission als 'hochwertige internationale Gutschriften' definiert. Mit anderen Worten: Projekte in Drittländer (meist Entwicklungsländern) zur Emissionsreduzierung zu verlegen, wie die Finanzierung von Elektrobussen in Bangkok oder von Photovoltaikanlagen in Marokko. Die Forderung nach einem 'Rabatt' von drei Prozent wurde vor allem von Deutschland nachdrücklich erhoben.“
Die nächste Dringlichkeitswelle wird kommen
Diederik Samsom, Physiker und sozialdemokratischer Ex-Politiker, klagt in seiner Kolumne in De Volkskrant über abgeschwächte Ziele:
„Es hätte der Kommission gut angestanden, wenn sie, klug dem Zeitgeist folgend, das Ziel von 2040 nicht abgeschwächt, sondern gestärkt hätte: denn das nutzt sowohl dem Klima als auch der Wettbewerbsfähigkeit und der Resilienz. ... Für neuen politischen Mut müssen wir offenbar auf die nächste Welle von Klimadringlichkeit warten. Sie wird kommen, und sie wird keinen Präsidentschaftskandidaten oder ein schwedisches Mädchen mehr brauchen. Die nächste Welle der Klimadringlichkeit wird durch den Klimawandel selbst verursacht werden. Dafür ist es inzwischen warm genug.“