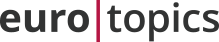Berlin: Absage an polnische Reparationsansprüche
Der neue polnische Präsident Karol Nawrocki hat bei seinem Antrittsbesuch in Berlin Polens Forderung nach einer Entschädigung von 1,3 Billionen Euro für die deutsche Besatzungszeit während des Zweiten Weltkrieges erneuert. Sowohl Bundeskanzler Friedrich Merz als auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wiesen die Forderung zurück, da die Frage aus deutscher Sicht rechtlich abgeschlossen sei. Kommentatoren diskutieren weiter.
Enorme Versäumnisse
Es ist richtig, dass Polens Präsident Nawrocki am Thema Reparationen festhält, meint Rzeczpospolita:
„Die Frage der Reparationen, Entschädigungen und Wiedergutmachungen hat angesichts der schrecklichen Verluste, die Polen während des Zweiten Weltkriegs durch Deutschland erlitten hat, ein enormes moralisches und emotionales Potenzial in den deutsch-polnischen Beziehungen. Die Versäumnisse der deutschen Seite bei der Wiedergutmachung sind enorm und offensichtlich. Es ist auch nicht wahr, dass deutsche Politiker sich dessen nicht bewusst sind. Deshalb reagieren sie so emotional und nervös auf die polnischen Forderungen und fürchten vor allem deren Auswirkungen auf ihr eigenes Image.“
Was ist eigentlich mit Reparationen aus Russland?
Weshalb fordert Polen eigentlich nur Entschädigung aus Deutschland, fragt Český rozhlas:
„Die Nazis haben zweifellos eine Vielzahl von Verbrechen auf polnischem Territorium und an der polnischen Nation begangen. ... Andererseits vertrieben die Polen 1945 zehn Millionen Deutsche aus dem heutigen Polen. ... Polen sollte jedoch an einer Entschädigung durch den zweiten Besatzer interessiert sein. Es war die Sowjetunion, die 1939 die östliche Hälfte des damaligen Polen besetzte und nie wieder an Polen zurückgab. ... Aber Reparationen vom befreundeten Deutschland zu fordern, ist heute zweifellos einfacher, als das ohnehin schon feindselige Moskau zu verärgern. Ob es jedoch klüger ist, darf man bezweifeln.“
Gemeinsam Putin abschrecken
Die Süddeutsche Zeitung wünscht sich deutliche Signale:
„Für die Forderung nach Reparationen mag die rechtliche Grundlage fehlen; eine starke Geste, auch für die wenigen noch lebenden NS-Opfer, ist überfällig. Das Vorhaben eines deutsch-polnischen Hauses in Berlin darf nicht versanden. Zentral aber ist die nicht ganz neue Idee, aus der historischen deutschen Verantwortung eine Aufgabe für die Gegenwart und Zukunft abzuleiten. Deutschland muss sich noch stärker als bisher am Schutz Polens vor der Bedrohung aus Russland beteiligen. Die Schäden, die Deutsche in Polen angerichtet haben, sind nicht wieder gutzumachen. Aber welche bessere Lehre ließe sich aus der Geschichte ziehen, als gemeinsam den Aggressor Russland abzuschrecken?“