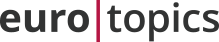Entwicklungshilfe: Was ist nötig und möglich?
Wie kann Entwicklungszusammenarbeit in Zeiten gigantischer Verschuldung der Entwicklungsländer und stark gekürzter Hilfsbudgets der Industriestaaten fortgesetzt werden? Diese Kernfrage prägte die UN-Konferenz, die am Donnerstag im südspanischen Sevilla zu Ende ging. Die USA, die unter Trump mehr als 80 Prozent der USAID-Projekte gestrichen hatten, schickten gar keine Delegation zur Konferenz.
Eine immense Finanzierungslücke
El País kommentiert die gemeinsame Erklärung:
„Das Dokument des UN-Gipfels zur Entwicklungsfinanzierung ist ein Bekenntnis zum Multilateralismus, in einer Zeit, die vom Abbau der internationalen Strukturen der Entwicklungszusammenarbeit und dem von den USA hinterlassenen Finanzvakuum gekennzeichnet ist. ... Die sogenannte Verpflichtung von Sevilla legt keine neue Agenda fest, sondern bekräftigt die Ziele, auf die man sich bei den vorangegangenen drei Konferenzen geeinigt hatte, bleibt jedoch hinter den Erwartungen der Zivilgesellschaft und den realen, aktuellen Bedürfnissen zurück. ... Es tut sich eine alarmierende Finanzierungslücke von vier Billionen Dollar auf, die fast dem jährlichen BIP von Deutschland oder Japan entspricht.“
Nachhaltige Entwicklung ist keine linke Verschwörung
El Mundo klagt über Rückschritte:
„Hunger und Armut beenden, ein gesundes Leben und eine hochwertige Bildung gewährleisten, Ungleichheit verringern. Dies sind einige der Ziele, die auf der Uno-Generalversammlung vor zehn Jahren für 2030 gesetzt wurden. ... Sie sind so vernünftig, dass man sich fragt, wer dagegen sein könnte. ... Tatsächlich schließen sich immer mehr einer Ideologie an, die Multilateralismus und Entwicklungszusammenarbeit bekämpft. ... Sie halten das Ganze für eine Verschwörung der Linken. ... Die Länder des globalen Südens verschulden sich immer mehr, während die Länder des Nordens aufrüsten. Die Welt steht heute viel schlechter da als vor zehn Jahren.“
Gefährliche Kürzungswelle
Die Kürzungen der US-Entwicklungshilfe unter Trump richten großen Schaden an, so The Guardian:
„Eine im Lancet veröffentlichte Studie sagt voraus, dass diese Einschnitte bis 2030 mehr als 14 Millionen Menschenleben kosten könnten, ein Drittel davon Kinder. ... Sein Schritt hat andere dazu ermutigt, es ihm gleichzutun. So kürzen beispielsweise Großbritannien, Deutschland und Frankreich ihre Entwicklungshilfebudgets, um mehr für Verteidigung auszugeben. ... Das sind nicht nur schlechte Nachrichten für Hilfsempfänger. Es ist ein schlechtes Zeichen für uns alle. Es wäre naiv zu glauben, die Hilfe sei rein altruistisch. So wie Konflikte Hunger und Armut hervorbringen, führen Ungerechtigkeit und Not zu Instabilität und einer gefährlicheren Welt.“
Kooperation und Klimapolitik gehen zusammen
In Libération fordert ein Kollektiv aus NGOs:
„Zehn Jahre nach dem Pariser Abkommen muss die Klimafinanzierung unbedingt solche Projekte unterstützen, die es verwundbaren Ländern ermöglichen, sich zu ehrgeizigen Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels und zur Anpassung an ihn zu verpflichten, ohne ihre Schuldenlast zu erhöhen. ... Was die Völker heute fordern, sind keine Almosen, sondern ein gerechtes globales Finanzsystem, das ihren Bedürfnissen und denen des Planeten nachkommt und in dem Entscheidungen nicht mehr nur von den reichen Ländern in ihren eigenen Interessen getroffen werden.“