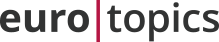Einigung im Zollstreit – zu welchem Preis?
Die EU und die USA haben ihren Zollstreit beigelegt: Künftig sollen in den USA Zölle in Höhe von 15 Prozent auf die meisten EU-Importe gelten, Europa erhebt keine neuen Gegenzölle. Donald Trump und Ursula von der Leyen vereinbarten am Sonntag in Schottland zudem umfangreiche Lieferungen von Energieträgern und Rüstungsgütern aus den USA. Die europäische Presse betrachtet Aspekte des Deals und zieht ihre eigenen Schlüsse.
Mit einem blauen Auge davongekommen
Europa hatte wenig Spielraum bei den Verhandlungen, meint Český rozhlas:
„Es scheint, dass weder Europa noch Japan und wahrscheinlich nicht einmal ein bedeutender Teil der übrigen Welt, der bisher kein Abkommen mit den USA schließen konnte, gleichberechtigte Partner sind, die sich dieselben Forderungen leisten könnten. Offenbar mit Ausnahme Chinas, wo das endgültige Abkommen noch ausgearbeitet wird und die Verhandlungen noch andauern. ... Der Handelskrieg ist in vollem Gange und Europa kommt mit einem blauen Auge davon. Europäische Produzenten und Exporteure werden von dem Abkommen kaum profitieren. In einer stabilen Welt ändert sich die Zollpolitik nicht täglich, sodass Amerikas Zölle zur neuen Realität werden.“
Ein Pyrrhussieg für die USA
Der Triumph der USA in dem Tauziehen ist längst nicht so eindeutig, urteilt Les Echos:
„Die Kommissionspräsidentin hätte kaum mehr erwarten können. Und es war besser, das vom Weißen Haus angekündigte Überbietungsrennen zu stoppen. ... Auch wenn noch einige Unklarheiten zu beseitigen sind, erhält Brüssel im Gegenzug Zusicherungen für wichtige Sektoren (Automobilindustrie, Luftfahrt, Spirituosen) und bekräftigt seine Regulierungsgrundsätze, insbesondere im digitalen Bereich. … Zudem muss der 'Sieg' Amerikas relativiert werden, denn man darf nie vergessen, dass in diesem protektionistischen Spiel alle verlieren – auch die USA, die ihre kurzfristigen Haushaltsgewinne mit zusätzlicher Inflation und geringerem Wachstum bezahlen werden.“
Märkte auf anderen Kontinenten erschließen
Europas Wirtschaft ist zum Glück nicht allein auf die USA angewiesen, betont Sydsvenskan:
„Die EU muss nun optimale Handelsabkommen schließen – mit Partnern, die darauf vertrauen, dass sich Freihandel mit der EU lohnt. ... Einen entsprechenden Schritt unternahm die EU bereits im vergangenen Dezember mit dem Mercosur-Abkommen für den Ausbau des Handels mit Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Dieser Exportmarkt steht in der EU bereits für mehr als 750.000 Arbeitsplätze, vor allem in der Automobil- und Fertigungsindustrie. Freihandel kann weitere Arbeitsplätze schaffen und Unternehmen wachsen lassen. Und so kann Europa reicher werden – völlig unabhängig davon, wer im Weißen Haus regiert.“
Im Reich der Fantasie
Die Verpflichtung der EU, Öl, Gas und Kernbrennstoffe von den USA für mindestens 750 Milliarden Dollar über drei Jahre zu kaufen, scheint Sega unrealistisch:
„Der Plan für große Energiegeschäfte klingt wie ein Hirngespinst. Weder kann die EU so viel importieren, noch können die US-Unternehmen so viel produzieren. Selbst wenn es dazu käme, würde es die Energieströme in der übrigen Welt empfindlich stören. Energieexperten haben schnell errechnet, dass die EU im Jahr 2024 Flüssigerdgas, Öl und Kohle im Wert von 64,55 Milliarden Dollar aus den USA bezogen hat. Das ist nur ein Viertel der durch von der Leyen versprochenen jährlichen Käufe im Wert von 250 Milliarden Dollar.“
Abkommen rückgängig machen
Die EU darf ihr Potenzial als starker internationaler Akteur nicht aufgeben, findet El País:
„Das 'Abkommen' offenbart Europas geopolitische Schwäche, wie sie sich bereits in der Ukraine und im Nahen Osten gezeigt hat. Und ihre wirtschaftliche Stärke nutzt sie nun auch nicht mehr. … Europa darf sich nicht mit seiner Bedeutungslosigkeit abfinden oder Trumps Verachtung für den Multilateralismus hinnehmen. Es muss dieses Abkommen, das bestenfalls das kleinere Übel ist, rückgängig machen. Andernfalls würde es den Kern des europäischen Projekts und seines Potenzials, ein starker internationaler Akteur zu sein, aufgeben: eine Union, die sich einer regelbasierten Weltordnung verpflichtet fühlt – einschließlich Handelsregeln.“
Brexit hat sich ausgezahlt
Dank des Bruchs mit der EU konnte London mit den USA ein eigenes und besseres Abkommen abschließen als Brüssel, frohlockt The Times:
„Während die EU mit einem generellen Zoll von 15 Prozent konfrontiert ist, beträgt jener für Großbritannien 10 Prozent. Auf Stahl und Aluminium lässt Trump einen Zoll von 50 Prozent auf Importe aus der EU erheben – doppelt so viel wie für jene aus Großbritannien. ... Der Hauptgrund für diesen Unterschied dürfte die Tatsache sein, dass Großbritannien nicht mehr in der EU ist. Dank der Flexibilität, eine eigene Handelspolitik zu gestalten, konnte London schneller als Brüssel handeln, um seine Interessen zu wahren.“
Hoher Preis für Stabilität
Kein fairer Deal, findet Corriere della Sera:
„Die EU zahlt einen hohen Preis für die 'Stabilität' in den Beziehungen zu den USA. ... Im Grunde genommen handelt es sich hierbei um eine politische Vereinbarung: Die EU wollte keinen frontalen Konflikt mit den USA. In der Zeit vor Trump lag der durchschnittliche Zollsatz, den die amerikanischen Zollbehörden auf europäische Waren erhoben, bei etwa 4,8 Prozent; jetzt wird er auf 15 Prozent festgesetzt. Das ist dreimal so viel, ohne dass es dafür eine echte wirtschaftliche Rechtfertigung gäbe, denn es stimmt nicht, wie Trump behauptet, dass Europa in den letzten Jahren die USA ausgebeutet hätte.“
Trump hat gepokert und gewonnen
15 Prozent kann man wohl kaum ein faires Ergebnis nennen, kritisiert De Standaard:
„Trump hat gepokert und gewonnen, weil er eigensinnig die Spielregeln umgeschrieben hat, die in jahrzehntelangen multilateralen Verhandlungen festgelegt wurden. Wenn die Spielregeln selbst verändert sind, dann ist nicht vorhersehbar, wie sich diese neuen Zölle auf die Volkswirtschaften der USA und der EU auswirken werden. In der alten Welt hätten die US-Verbraucher den Preis dafür bezahlt: Handelszölle verteuern das Leben, hemmen Innovationen und kosten Wohlstand. In Trumps Welt machen sie die USA reicher auf Kosten der Handelspartner.“
Schlechter als erhofft, besser als befürchtet
Die EU hat sich notgedrungen den Forderungen Trumps gebeugt, analysiert NRC:
„In den letzten Wochen wurden Risse sichtbar in der Einheitsfront, die die EU zeigen wollte. Länder, die viel zu verlieren hätten, wenn ihre Unternehmen mit hohen Zöllen konfrontiert würden, wie Deutschland und Italien, wurden nervös. Andere, allen voran Frankreich, hatten die Nase voll von den Drohungen und waren der Meinung, dass die EU härter durchgreifen sollte. So gesehen war das Ergebnis eines, das auch die europäischen Diplomaten erleichtert aufatmen ließ. Schlechter als erhofft, besser als befürchtet.“
Waffen sind wieder im Holster
The Irish Times atmet auf:
„Die Einigung hat einen großen Vorteil. Sie verhindert einen drohenden Zollkrieg zwischen beiden Seiten, der hätte hässlich werden können. ... Es hätte zu einem Schlagabtausch mit einer Retourkutsche nach der anderen kommen können. Doch nun ist der Schusswechsel vorbei und die Handelswaffen sind zumindest vorübergehend wieder im Holster. Irland ist stark von US-Investitionen und US-Handel abhängig und wäre im Falle eines Handelskriegs besonders gefährdet. Bei einem solchen müssten besonders die großen digitalen Technologieunternehmen mit umfangreichen Niederlassungen in Irland negative Konsequenzen fürchten.“