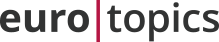Wie sollte man mit russischer Softpower umgehen?
Der von Russland gegen die Ukraine geführte Krieg wird zunehmend auch als nicht nur mit Waffengewalt ausgetragener Kampf gegen das westliche Lebensmodell insgesamt wahrgenommen. Ein Blick in die Kommentarspalten europäischer Medien zeigt, dass man sich auf ganz unterschiedlichen Ebenen die Frage stellt, wie mit direkter oder indirekter russischer Einflussnahme umzugehen ist.
Als Kulturförderung getarnte politische Kampagnen
Einer Recherche der Zeitung Eesti Ekspress zufolge fließen systematisch Kreml-Gelder an Privatpersonen, die die öffentliche Meinung in Estland beeinflussen sollen. Die zur selben Verlagsgruppe gehörende Eesti Päevaleht fasst die Ergebnisse zusammen:
„Es ist ein außergewöhnlicher Einblick in die geheime Welt der russischen Einflussagenten. ... Der Fonds für Rechtsschutz und Hilfe für im Ausland lebende russische Staatsbürger (Pravfond) ist zweifellos ein Instrument des Kremls, das eng mit den russischen Geheimdiensten und deren subversiven Aktivitäten verbunden ist. ... Viele, die seit Jahren in westlichen Ländern wie Estland leben, betreiben prorussische Politik, präsentieren sich dabei als 'Verteidiger von Minderheiten' und der 'russischen Kultur und Sprache', tun dies aber als Werkzeuge des Kremls. Ganz bewusst.“
Logik des Hasses in sozialen Medien
Wer in die Social-Media-Kanäle russischer Bewohner in Estland schaut, entdeckt eine abgekoppelte Parallelwelt, stellt Postimees fest:
„Es gibt dort ein 'alternatives Estland'. Es hat eine völlig andere Geographie, Geschichte, Gesetzgebung, Statistik – und sogar andere Gesetze der Physik und Weltordnung. ... Die Logik ist völlig anders. Oberflächlich betrachtet, machen die Gruppen einen anständigen Eindruck: Ankündigungen von städtischen Veranstaltungen, Verweise auf russischsprachige Lokalmedien. Aber wer die Kommentare unter einem beliebigen Beitrag anschaut, erkennt die Abgründe des Hasses. ... Die Gruppen haben auch eine nützliche Funktion. Sie helfen beim Dampfablassen.“
Sprache als Vehikel für Mentalitätsballast
In Litauen sind nur fünf Prozent der Bevölkerung ethnische Russen. Dennoch ist der Einfluss der russischen Sprache dort hoch, glaubt der Berater in Sicherheitsfragen Aurimas Navys auf Bernardinai:
„In welcher Sprache fluchen litauische Jugendliche? Meist auf Russisch. ... 80 Prozent unserer Bevölkerung verstehen Russisch. ... Wer eine Sprache gut beherrscht, übernimmt oft auch die Denkweise des jeweiligen Volkes. Dass 80 Prozent Russisch verstehen, ist eine Folge der Besatzung – und zugleich der Grund, warum sich die Mentalität vieler auch nach 35 Jahren Unabhängigkeit kaum verändert hat. Meine Hoffnung liegt bei jungen, großartigen Menschen, die kein Russisch sprechen, aber gute Filme drehen, Unternehmen gründen, in Konzernen arbeiten usw. Vielleicht sind sie naiv, weil sie in einer besseren Umgebung aufgewachsen sind. Aber sie tragen keinen russischen Mentalitätsballast.“
Keine Olympiade mit russischem Eishockeyteam
Während in Dänemark und Schweden gerade die Eishockey-WM ausgetragen wird – Russland wurde ausgeschlossen –, ruft Aftonbladet zum Boykott auf, sollte das IOC die russische Nationalmannschaft für die olympischen Winterspiele 2026 zulassen:
„Putin nutzt Eishockey als politisches Instrument. Der Starspieler der russischen Nationalmannschaft, Alexander Owetschkin, hat an offiziellen Unterstützungskampagnen und der Propaganda des Regimes teilgenommen. ... Wenn Russland an den Olympischen Spielen teilnehmen darf, müssen die nationalen Hockeyverbände, Trainer und Spieler im Chor widersprechen. Drei Kronen [die schwedische Mannschaft] werden nicht gegen Putins Team antreten.“