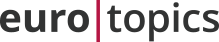Das Adrenalin der Metropole verpufft
Die Journalistin Lucía Taboada schildert in eldiario.es die Folgen der hohen Mieten in Madrid:
„Drei Menschen aus meinem Umfeld haben Madrid verlassen, um in ihre kleinen Heimatorte zurückzukehren oder günstiger auf dem Land zu leben. Einer von ihnen sprach von 'Versagen', weil er es nicht geschafft habe, finanziell erfolgreich zu sein. ... Er verlässt Madrid, weil er sich mit über 35 Jahren keine Miete leisten kann, ohne in eine WG zu ziehen. Diese Tragödie erdrückt Madrid. ... Das Versagen liegt nicht bei ihm, sondern bei der Stadt. ... Freiheitsversprechen oder bis sechs Uhr morgens geöffnete Bars sind da wertlos. ... Und es geht nicht nur um den Verlust des hauptstädtischen Adrenalinrauschs oder des Karrierehorizonts, sondern um etwas Wichtigeres: das Recht dazuzugehören.“
Die Einkommen hinken hinterher
Theoretisch könnten die steigenden Mietpreise durch höhere Gehälter aufgefangen werden, schreibt Expresso:
„Natürlich steigen die Mieten und Immobilienpreise seit viel zu langer Zeit stark an und sind für einen Großteil der Portugiesen unerschwinglich. Aber nicht die Tatsache, dass die Mieten oder Quadratmeterpreise steigen, definiert das Ausmaß des Problems, sondern der Vergleich zwischen Miete (oder Hypothekenrate) und Löhnen (oder Renten) macht die Dramatik deutlich. Die Tatsache, dass die Einkommen nicht mit den Preisen Schritt halten, sollte Anlass zur Sorge geben, nicht der nominale Wert der Dinge an sich. Auch Löhne steigen im Laufe der Zeit. Die Frage ist, was wir uns mit ihnen leisten können.“
Mehr Wohnfläche dank Gartenlauben
Die irische Regierung hat die zulässige Größe von Hütten oder Gartenhäusern auf 45 Quadratmeter erhöht – für The Irish Independent ein Schritt in die richtige Richtung:
„Die neue Regelung ist kein Allheilmittel zur Lösung der chronischen Wohnungskrise. Wir sollten sie als das anerkennen, was sie ist: eine kleine, aufsehenerregende Idee, die Teil eines Maßnahmenpakets sein kann, um uns aus der aktuellen Misere zu befreien. ... Darüber hinaus könnte sich diese Maßnahme mit einem anderen Thema verbinden, das mehr Aufregung generiert, als Lösungen produziert: die Verkleinerung von Wohnraum für ältere Bewohner, um größere Wohnungen für die nächste Generation freizumachen.“
Freizeitpark ohne urbanes Leben
In den vergangenen zehn Jahren sind die Quadratmeterpreise in Kopenhagen um fast 70 Prozent gestiegen. Diese Entwicklung wird die Stadt immer lebloser machen, ist Jyllands-Posten überzeugt:
„Die einfachen Kopenhagener – Krankenpfleger, Pädagogen, Busfahrer, Akademiker in prekären Branchen – werden immer weiter aus der Stadt verdrängt. Es ist sowohl ein soziales als auch ein kulturelles Versagen, die Immobilienpreise in Großstädten in den Himmel schnellen zu lassen. ... Eine Stadt, in der sich nur die Reichsten und Touristen ein Leben leisten können, wird zur toten Kulisse. ... Wollen wir, dass Kopenhagen zu einer Art von Architektur-Disneyland wird, das nur noch für Wohlhabende zugänglich ist? Oder soll es weiterhin eine Stadt sein, in der Kinder geboren werden und alle möglichen Menschen leben, arbeiten und alt werden?“
Wohnungspolitik für Wohlhabende
Die Wartezeit für eine Mietwohnung in Stockholm liegt bei durchschnittlich zehn Jahren, weshalb viele Menschen stattdessen einen Wohnungskauf erwägen. Doch auch dieser Weg ist steinig, kritisiert Dagens Nyheter:
„In einem Bericht des schwedischen Immobilienverbandes heißt es, eine junge Familie in Stockholm müsse bis zu 30 Jahre sparen, um sich die Anzahlung für ein Eigenheim leisten zu können – der Babyboomer-Generation, die zwischen den 1970er und 1990er Jahren ein Eigenheim kaufte, reichten drei Jahre. ... Ein Eigenheim ist kein Ort zum Schlafen, Essen, Lieben, Pflegen und Leben mehr. Im heutigen Schweden sieht man es eher als Investition. ... Ein weiteres Problem ist die Möglichkeit, Zinskosten für Kredite steuerlich abzusetzen - das versetzt Eigenheimbesitzer in die Lage, hohe Kredite aufzunehmen, was die Immobilienpreise wiederum in die Höhe treibt.“
Kein ruhiger Platz zum Lernen
Die Wohnkrise gefährdet Chancengleichheit und Bildungserfolg, warnt Clarisse Petel, Logopädin beim Brüsseler Sozial- und Gesundheitszentrum Cerapss, in einem Gastbeitrag in Le Soir:
„Es ist offensichtlich: Ohne angemessenen Wohnraum und ohne die Gewissheit, dort bleiben zu können, rückt die Lernbereitschaft von Eltern und Kindern in den Hintergrund. Unsere Bemühungen, Bildungsungleichheiten abzubauen, hängen direkt von der Sicherheit und Stabilität der Wohnsituation der Kinder ab. Der Erfolg sozialer Arbeit wird in vielerlei Hinsicht davon bestimmt, wie die Politik auf die Krise des bezahlbaren Wohnraums reagiert. Die von uns betreuten Familien müssen oft minderwertige Wohnungen akzeptieren und nur wenige Kinder haben einen ruhigen Ort, um ihre Hausaufgaben zu machen.“