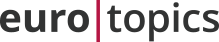Internationale Konflikte: Welche Rolle bleibt Europa?
Der Kontinent ist aus der Zeit gefallen
Expresso schreibt:
„Es ist verständlich, warum Europa nicht mitmischt. Es hat nicht die Macht, eine der beiden Seiten unter Druck zu setzen. Es hat keine Flugzeugträger, die es in die Region schicken könnte, keine Bomber, die das iranische Atomprogramm bedrohen könnten, und keine großen Geschäfte mit den Golfmonarchien zu machen. Und selbst wenn es diese hätte, wäre es nicht bereit, sie einzusetzen oder mit ihrem Einsatz zu drohen. ... Wir leben in einer Zeit, in der die Stärke der Diplomatie im Wesentlichen von der Bereitschaft abhängt, andere Machtmittel einzusetzen oder zwischen Staaten Geschäfte zu machen – mehr als zwischen bloßen Volkswirtschaften. Europa ist nicht in dieser Zeit angekommen.“
EU sollte sich auf die Ukraine konzentrieren
Die Europäische Union hat Wichtigeres zu tun, als sich im Nahen Osten zu engagieren, findet Die Zeit:
„[N]ämlich ihr eigenes Überleben als Union zu sichern. Im Nahen Osten steht das nicht auf dem Spiel. Sehr wohl aber in der Ukraine, wo Wladimir Putin seinen imperialistischen Feldzug mit größter Härte weiterführt. Gerade eben haben die Chefs der drei deutschen Geheimdienste öffentlich sehr deutliche Warnungen ausgesprochen: 'Wir dürfen uns nicht zurücklehnen und denken, ein russischer Angriff kommt frühestens 2029. Wir stehen schon heute im Feuer'. ... Es geht Putin darum, die EU zu zerlegen. Und die EU muss alle Kraft darauf aufwenden, dass das nicht geschieht – sonst bricht eine Ära europäischer Kleinstaaterei an. Das kann kein Europäer und keine Europäerin wollen.“
Es geht nicht nur um Kyjiw
Es zeichnet sich eine Umgestaltung der Weltordnung ab, beobachtet Új Szó:
„Gegen Ende 2025 ist der Krieg zu einer Probe der Geduld, der Ressourcen und der Legitimität geworden. Moskau ist militärisch stärker, Kyjiw wird immer müder, der Westen ist gespalten und wehrlos, während er selbst nicht weiß, was 'Sieg' für ihn bedeutet. Die Tomahawk-Debatte, die Angriffe auf das Energiesystem und die Frage des russischen Vermögens [ob Europa zur Finanzierung der Verteidigung der Ukraine auf die beschlagnahmten russischen Vermögenswerte zugreifen soll] weisen auf dasselbe hin: Bei dem Konflikt geht es nicht mehr um die Ukraine, sondern um die Umgestaltung der Weltordnung – und niemand hat mehr die Ereignisse im Griff.“
Strategische Neuorientierung nötig
Europa braucht Druckmittel, um Angreifer in Schach halten zu können, schreibt der politische Analyst Miguel Baumgartner in O Jornal Económico:
„Manche sagen, dass man nicht mit denen verhandelt, die bombardieren. Das ist verständlich. Aber man verhandelt immer mit Feinden, nicht mit Freunden; mit Freunden hält man Gipfeltreffen ab. Die Frage ist, wer die Bedingungen festlegt. Wenn es Washington-Moskau (oder Ankara-Moskau) sind, wird Europa doppelt bezahlen: im Haushalt und in der Sicherheit, mit fragilen Grenzen und einem verheerenden Präzedenzfall. Ein erwachsenes Europa braucht ein 'europäisches Zentrum für den Frieden' – nicht um Aggressionen zu belohnen, sondern um einen Prozess in Gang zu setzen, bei dem die Kosten für ein Weitermachen [mit Krieg und Aggression] höher sind als die Kosten für ein Aufhören.“
Nur eine starke Wehrkraft kann Frieden sichern
Militärisch schwache Länder sind ein gefundenes Fressen für Aggressoren, betont die Kleine Zeitung:
„Schaut man auf die europäischen Länder, erkennt man in Sachen Wehrhaftigkeit und Verteidigung ein buntes Sammelsurium von Lösungen. Wehrpflicht, Wehrpflicht abgeschafft, abgeschafft mit Verpflichtungen im Notfall, Freiwilligendienst für Männer und Frauen, dann nur für Männer, zwischen vier und zwölf Monaten. Am Beispiel Deutschlands sieht man, wie schwierig es ist, den Status quo zu ändern. ... Wir müssen nach Jahrzehnten des Träumens einräumen, dass nur eine starke Wehrkraft den Frieden sichern kann – wer schwach und leicht einzunehmen ist, hat gegenüber einem Aggressor keine Karten. Fast noch wichtiger: Es geht nicht nur um die Zahl von Soldaten, es geht auch um deren Haltung.“