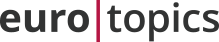80 Jahre Kriegsende: Was bewegt Europa?
Vor 80 Jahren ging in Europa der Zweite Weltkrieg mit der Kapitulation des nationalsozialistischen Deutschlands am 8. Mai zu Ende: ein besonderer Anlass für Gedenkfeiern. Russland erinnert am 9. Mai mit einer Militärparade an den Sieg im "Großen Vaterländischen Krieg". In den europäischen Kommentarspalten finden sich angesichts aktueller Konflikte sehr nachdenkliche Stimmen.
Helden, die uns eine bessere Welt beschert haben
Ermutigende Worte findet The Times:
„Trotz der gegenwärtigen pessimistischen Stimmung in Großbritannien und der anhaltenden gewaltsamen Konflikte im Ausland ist es wichtig festzuhalten, dass sich die damaligen Hoffnungen auf eine bessere Welt weitgehend erfüllt haben. Auch wenn die Sehnsucht nach vergangenen Zeiten in Mode sein mag, ist das Leben in Großbritannien im Jahr 2025 – gemessen an allen Indikatoren wie Gesundheit, Wohlstand, Wissen, Toleranz oder persönlicher Freiheit – unermesslich besser als 1945, ganz zu schweigen von 1940 oder 1935. Die Soldaten und Soldatinnen haben die freie Welt vor einer brutalen Tyrannei bewahrt. ... Weder die Opfer der Gefallenen noch der Optimismus der Überlebenden waren umsonst. Wir verneigen uns erneut vor ihnen, sie alle sind Helden.“
Mitgefühl zeigen ohne falsche Huldigung
Bundeskanzler Merz sollte am 9. Mai nach Moskau fliegen, findet die Berliner Zeitung:
„Es muss nicht unbedingt ein Besuch der großen Militärparade auf dem Roten Platz oder auf einem der begehrten Sitze auf der Kremltribüne neben Xi Jinping, Alexander Lukaschenko oder dem nordkoreanischen Herrscher Kim Jong-un sein. Doch wie wäre es mit einem stillen, unerwarteten Besuch am Grabmal des unbekannten Soldaten oder am Jeschi-Denkmal in Chimki vor den Toren Moskaus – jeweils Orte, die an die Opfer des Krieges erinnern, nicht an dessen Verherrlichung. Merz würde eine Geste des Mitgefühls zeigen, ohne Putins Propaganda zu legitimieren.“
Fico spielt mit antiwestlicher Stimmung
Die Teilnahme des slowakischen Premiers bei der Militärparade in Moskau kritisiert Denník N:
„Wenn Fico bei den Feierlichkeiten erscheint, wird ihm die Armee vorgeführt, die derzeit die Ukraine dezimiert. Er wird neben einem Diktator stehen, der sie am liebsten aus der Welt schaffen würde. ... Fico fragt [mit Blick auf seine Moskau-Reise], welche slowakischen Politiker im Laufe nur weniger Stunden schon bilaterale Gespräche mit dem chinesischen Präsidenten, dem brasilianischen Präsidenten und dem Präsidenten der Russischen Föderation geführt hätten. Das ist seine Masche. Zuhause häufen sich die Probleme. Und er lenkt davon ab, indem er mit der antiwestlichen Stimmung eines großen Teils der slowakischen Gesellschaft spielt und sich selbst als respektierter Staatsmann geriert.“
Alte Fehler nicht wiederholen
Kolumnist Edward Lucas hebt in 15min hervor:
„Trotz aller pathetischen Reden vom 'ewigen Ruhm' hat der Kult um den 'Großen Vaterländischen Krieg' den Test der Zeit nicht bestanden. Bis in die Breschnew-Ära hinein war der Krieg in der Sowjetunion ein traumatisiertes Tabuthema. Erst als die realen Erinnerungen verblassten, machte sich eine Sehnsucht nach verklärtem Heldentum breit – nicht nur in Russland. Auch andere Länder pflegen einen egozentrischen und selektiven Umgang mit der Geschichte. Es ist völlig richtig, den Tag des Sieges in Europa zu feiern – am 8. Mai für die westlichen Alliierten, beziehungsweise am 9. Mai. ... Aber die beste Art, die Opfer der Gefallenen zu ehren, ist, über die Fehler nachzudenken, die zum Krieg führten.“
Aufrüstung und Krieg überschatten den Jahrestag
Was damals verteidigt wurde, ist heute wieder in Gefahr, warnt The Irish Times:
„An diesem besonderen Jahrestag, an dem der Zweite Weltkrieg von der lebendigen Erinnerung in die Geschichtsbücher übergeht, gibt es Grund zur Sorge, dass seine Lehren in Vergessenheit geraten. Der größte militärische Konflikt in Europa seit 1945 wird derzeit von einem russischen Diktator gegen die demokratische Ukraine geführt. Überall auf dem Kontinent wird eifrig aufgerüstet. Demagogen, die mit Blut und Boden-Nationalismus operieren, erleben ein Comeback. In Deutschland liegt eine Partei, die offen mit Nazi-Symbolen kokettiert, in manchen Umfragen vorn. Und das transatlantische Bündnis, das den Wiederaufbau Europas nach dem Krieg getragen hat, bröckelt.“
Aus der Vergangenheit lernen
Der Historiker Xosé Manuel Núñez Xeixas fordert in El País ein gemeinsames, europäisches Gedenken:
„Im Westen symbolisierte der 8. Mai den neuen antifaschistischen Nachkriegskonsens, basierend auch auf selektivem Vergessen: Kollaboration mit den Nazi-Invasoren in Frankreich, den Niederlanden oder Norwegen, Beteiligung an der Deportation von Juden oder Teilnahme an Freiwilligeneinheiten des Dritten Reiches. Für Deutschland war es [lange] ein trauriges Datum. ... Erst 1985 erinnerte Richard von Weizsäcker daran, dass Deutschland am 8. Mai vom Faschismus befreit worden war: ein Datum also, um aus der Vergangenheit zu lernen. ... In Italien, verankert im antifaschistischen Diskurs, überdeckte der Mythos des Widerstands jeden Gedanken an Mitverantwortung. ... Jetzt, wo die extreme Rechte wieder wächst, sollten wir dem 8. Mai über die nationalen Gedenkfeiern hinaus eine europäische Dimension geben.“