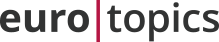80 Jahre Hiroshima: Haben wir gelernt?
Die japanische Stadt Hiroshima hat mit dem Läuten der Friedensglocke und einer Schweigeminute der Opfer des Atombombenabwurfs vor 80 Jahren gedacht. Bei dem ersten Kriegseinsatz einer Nuklearwaffe durch die USA starben Zehntausende Menschen. Europäische Kommentatoren debattieren vor diesem Hintergrund über Abschreckungslogik und Kriegsgefahren.
Atomare Gefahr größer denn je
Nuklearwaffenfreiheit ist immer noch wichtig, erinnert El País:
„Der Gedenktag fällt mit einer beunruhigenden Rhetorik zusammen: Moskau verweist auf seine atomare Zerstörungskraft, um Kyjiws Verbündete abzuschrecken. ... Donald Trump reagiert mit der Ankündigung der Mobilisierung zweier Atom-U-Boote, Europa will mehr nukleare Abschreckung, mit Frankreich und Großbritannien an der Spitze, und der Angriff der USA und Israels auf den Iran hat das iranische Regime davon überzeugt, dass Atomwaffen überlebenswichtig sind. ... Die nukleare Bedrohung ist keine bloße Rhetorik, die Menschheit darf das Ziel, sich davon zu befreien, nicht aufgeben.“
Die eigene Verantwortung begreifen
Auch Länder, die keine eigene Atombombe besitzen, wie Belgien, sollten ihre Rolle ernst nehmen, mahnt L’Echo:
„Von Anfang an hat es [Belgien] – über die Shinkolobwe-Mine in [damalige Provinz von Belgisch-Kongo] Katanga – das Uran geliefert, das zur Herstellung der auf Japan abgeworfenen Bomben diente. ... In einer Zeit, in der Europa einen Schlussstrich unter die 'Friedensdividenden' setzt und massiv in seine Aufrüstung investiert, kauft die belgische Regierung F-35-Kampfjets anstatt Konkurrenzmarken, um in der Lage zu sein, im Land stationierte Atomwaffen abzuwerfen. Wie alle Beteiligten an diesem aus dem Kalten Krieg geerbten atomaren Abschreckungssystem darf Belgien nie den Ernst seiner Rolle aus den Augen verlieren. Die nukleare Abschreckung ist eine Wette und in der Welt der Putins und Trumps scheint diese so riskant wie nie zuvor.“
Zeugnis menschlicher Dummheit
La Stampa empört sich über die Leichtfertigkeit, mit der heutzutage mit Nuklearwaffen gedroht wird:
„Es scheint ein unglaubliches Zeugnis menschlicher Dummheit zu sein, dass 80 Jahre nach dem 'Was haben wir getan?' sich sowohl die Zahl der Länder mit nachgewiesenen oder mutmaßlichen Atomwaffenarsenalen als auch die große Zahl der Aspiranten vervielfacht haben. ... 80 Jahre nach Hiroshima sind wir entmutigt durch Kriege am Rande einer nuklearen Katastrophe. Unglückselige Politiker schwingen bedrohlich mit diesen Waffen, als wären es Juwelen, die zu lange im Safe aufbewahrt wurden. Sie setzen U-Boote und Raketen ein, um zu zeigen, dass die Nicht-Waffe wieder zu einer Waffe geworden ist.“
Gefährliche Schritte in die falsche Richtung
Die von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron angestrebte Ausweitung des französischen Atomschirms auf Europa trägt zu einer tödlichen Flucht nach vorne rund um den Globus bei, warnt eine Gruppe von NGOs in Libération:
„Die im Atomwaffenverbotsvertrag engagierten Regierungen haben es erkannt: Die atomare Abschreckung ist nicht die Lösung, sondern das Problem. Sie fördert eine Logik der Konfrontation, verstärkt das Wettrüsten (mit nuklearen wie konventionellen Waffen), schwächt Verträge und legitimiert Drohungen als Beziehungsmodus zwischen Staaten. Die Idee, die französische Abschreckung zu europäisieren, ist eine gefährliche Verkettung. Sie wird Reaktionen Russlands hervorrufen, die Ambitionen anderer Atommächte oder atomarer Schwellenländer nähren und das Ende des Atomwaffensperrregimes vorantreiben.“
Kluft zwischen Moral und Technologie wächst
Die Autorin Irene Lozano zieht in eldiario.es eine Parallele zur Erfindung der KI:
„Dank der Atombombe sind wir die erste Generation, die alle Generationen auslöschen kann. Die Entwicklung künstlicher Intelligenz – ausgerichtet auf Geld und Macht – trifft den Kern dieser Sorge. … Die Kluft zwischen moralischer Handlungsfähigkeit und technologischer Macht wächst, aber acht Milliarden Menschen können nicht die moralischen Folgen von KI kontrollieren. … Die Verantwortung müssen wir von den Konzernen verlangen. … Und die demokratischen Regierungen müssen ihnen ihre Grenzen setzen. … Ihre Entwicklungen dürfen unser Verständnis nicht übersteigen, sonst fällt eine neue Atombombe auf ein neues Hiroshima.“