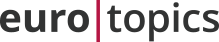Verhandlungen in Istanbul: Zum Scheitern verurteilt?
Mit einem Tag Verzögerung beginnen am heutigen Freitag in Istanbul die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland, zu denen ihr Initiator Wladimir Putin allerdings nicht angereist ist. Er verlängerte derweil den russischen Verteidigungsplan um zwei Jahre. Die EU plant, am Dienstag neue Sanktionen gegen Russland zu verhängen.
Kein Grund für Katastrophenstimmung
Der liberale Politiker Lew Schlosberg sieht auf Facebook schon in der Tatsache des russisch-ukrainischen Treffens einen großen Fortschritt:
„Die Präsidenten sind die oberste Ebene. Sie können sich nur dann treffen, wenn auf Delegationsebene eine Absprache über alle wichtigen Bestimmungen des Abkommens erzielt ist. Die Chance für ein solches Treffen ist nicht verloren, aber innerhalb einiger Tage kann man es durch Minenfelder nicht erreichen. Es gibt keinen Grund für Katastrophenstimmung. Noch vor sechs Monaten war an ein Treffen in Istanbul nicht zu denken, geschweige denn davon zu reden.“
Ein Platzen der Gespräche wäre fatal
Die Tageszeitung Die Presse kritisiert die Hast, mit der die Gespräche anberaumt wurden:
„Der sogenannte Istanbul-Gipfel ist eine Charade Putins, mit der er Trump bei Laune halten will. Zugleich wäre jeder auch noch so kleine Fortschritt willkommen: Direkte Gespräche zwischen den Kriegsparteien, egal, auf welcher Ebene, sind die Voraussetzungen dafür, dass ein Waffenstillstand oder vielleicht sogar eine Friedensvereinbarung zustande kommen. Solche Verhandlungen müssen jedoch gut vorbereitet sein, sonst führen sie ins Nirgendwo. Die überhastet angesetzte Show von Istanbul birgt eine Gefahr: Wenn Verhandlungen wie diese platzen, öffnet sich in der Regel nicht so schnell ein neues Fenster. Die verpasste Chance könnte zu einer Eskalation des Kriegs führen.“
Putin muss bei Trump punkten
Putin ist mehr an einer Einstellung der Kämpfe interessiert als er zeigt, wirft Corriere della Sera ein:
„Donald Trumps zweite Amtszeit hat Putins Prioritäten verändert. Der russische Präsident hätte zwar nichts dagegen, den Krieg fortzusetzen, zumal er glaubt, einen Vorteil zu haben. ... Doch hält er die Aufrechterhaltung der neu aufblühenden Freundschaft mit dem amerikanischen Präsidenten für wesentlich wichtiger. Denn sie könnte langfristig zu Vereinbarungen über die Arktis, Gas- und Ölpreise führen, deren drastischer Fall die ohnehin schon angeschlagene russische Wirtschaft zu strangulieren droht. Das Ende der Feindseligkeiten könnte das Instrument sein, um das Vertrauen des Weißen Hauses dauerhaft, wenn auch nicht endgültig, zu gewinnen.“
Der langsame Tod internationaler Institutionen
Die Aussichten für die Ukraine und das internationale System stehen schlecht, klagt Politologe Sébastien Boussoir in La Tribune:
„Dieser Konflikt kündigt die Paradigmen neuer Konflikte an, die nicht mehr im multilateralen Rahmen und innerhalb der Uno beigelegt werden, sondern bei denen in bilateralen Verhandlungen schmerzhafte Ergebnisse herausgepresst werden, die hastig vereinbart und auch wieder aufgekündigt werden können. … In diesem Kontext wird alles flüchtig, nichts ist dauerhaft bindend. Wir wohnen also machtlos dem langsamen, aber sicheren Tod eines internationalen Systems bei, das uns 70 Jahre lang in Hoffnung, aber auch in Illusionen gewiegt hat.“
Europa verschafft sich seinen Platz
Überrascht hat La Libre Belgique nicht nur, dass Trump die Unterstützung der Ukraine doch vorerst nicht aufgibt,
„[s]ondern auch das Aufschrecken eines schwachen und ungeeinten Europas. ... Seit mehreren Wochen sieht man nur sie drei: den deutschen Kanzler Friedrich Merz, den britischen Premier Keir Starmer und den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Diese vor einem Jahr noch inexistente Troika zeigt sich entschlossen, kohärent und geeint. Natürlich ist es noch zu früh, um abzusehen, wohin dies führen wird. Doch dieses Europa, das entschlossen von Polen sowie den baltischen und skandinavischen Ländern unterstützt wird, verschafft sich in diesem Konflikt langsam seinen Platz.“
Putin glänzt erwartungsgemäß durch Abwesenheit
Lidové noviny war klar, dass der Kreml-Chef nicht selbst nach Istanbul reisen würde:
„Der letzte Nagel im Sarg von Putins Teilnahme war die Energie, mit der der ukrainische Präsident Selenskyj und europäische Staatsmänner ihn zur Teilnahme ermutigten. Selenskyj, Bundeskanzler Friedrich Merz und andere argumentieren eindeutig und sachlich richtig: Wenn Putin nicht in Istanbul erscheint, bedeutet das, dass er ein Betrüger ist und nicht wirklich Interesse an einem Deal hat. Doch das ist ein Spiel, das Putin niemals spielen wird. Er verliert nicht gern die Kontrolle über die Lage. Würde er fliegen, sähe es so aus, als hätte er dem europäischen Druck nachgegeben. Und das ist etwas, was Putin niemals zulassen wird – weder vor seinem heimischen Publikum, noch vor sich selbst.“
Frieden kann sich der Kremlchef gar nicht leisten
Der Publizist Jurij Bohdanow erklärt in einem von Espreso übernommenen Facebook-Post, warum Frieden für Putin nicht von Interesse sein könnte:
„Die Wirtschaft wieder umzustellen, ist kompliziert und teuer. Die Rückkehr Hunderttausender Veteranen würde zu sozialen Spannungen führen. Die Eliten wären unzufrieden, weil die Ergebnisse nicht die Verluste rechtfertigen. Um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, wären enorme Auslandsinvestitionen erforderlich, die es nicht geben wird. Deshalb ist der gegenwärtige Zustand (der Krieg als Mittel zur Kontrolle sowie zur Beseitigung der marginalisierten Bürger und zur Bereicherung der Eliten) für ihn ein Zustand der Homöostase. Selbst wenn dies unvermeidlich zu einem Zusammenbruch des Systems führt – ähnlich wie chronischer Alkoholismus.“
Den Westen wieder zusammengeschweißt
Auch wenn Putin nicht teilnimmt, hat die Sache ihr Gutes, schreibt La Stampa:
„Er wird von drei Seiten unter Druck gesetzt, die Einladung anzunehmen: von den europäischen Staats- und Regierungschefs, von Wolodymyr Selenskyj und von Donald Trump. Durch diese Einigkeit steht der russische Präsident mit dem Rücken zur Wand. Er hat allerdings kein Problem damit, jedem Nein zu sagen. Das hat er mit seinem Krieg bewiesen. Aber indem er nicht nach Istanbul reist, schweißt er die Front zwischen Washington, der Ukraine und Europa wieder zusammen, in die er einen doppelten Keil zwischen den USA und der Ukraine sowie zwischen Washington und Europa geschlagen zu haben glaubte. Zudem hat er die Maske fallen lassen, was den Willen zur Beendigung des Kriegs betrifft. Was keine große Neuigkeit ist.“
Militärisch alles andere als Friedenszeichen
Vor einer größeren russischen Offensive warnt der Ex-Abgeordnete und Blogger Boryslaw Beresa in einem von gazeta.ua übernommenen Facebook-Post:
„An der Front glaubt niemand an irgendwelche Verhandlungen in Istanbul oder an Versprechungen, dass es eine Waffenruhe geben werde. Die Besatzer haben die Aufstellung von 15 Divisionen abgeschlossen und sie beabsichtigen nicht etwa, Herbarien zu sammeln, sondern sie wollen im Sommer und Herbst eine Großoffensive durchführen. Das ist wohl die beste Antwort auf die Frage, ob man von dem Treffen am 15. Mai in Istanbul etwas erwarten darf.“
Zwei gegen einen – und der wäre Selenskyj
Soziologe Igor Eidman sieht eine Option, wie Moskau den Spieß umdrehen könnte:
„Putin könnte beschließen, mit Selenskyj nur im Beisein des US-Präsidenten zu verhandeln, falls er sich [zuvor] mit diesem absprechen kann – also zwei gegen einen. Dies könnte zu einem weiteren Skandal und der Einstellung der US-Hilfe für die Ukraine führen. Sollte der Kreml plötzlich einen Besuch Putins in Istanbul zu Gesprächen mit Trump ankündigen (so würde es in Russland offiziell dargestellt, Selenskyj nimmt man dann sozusagen dazu), dann heißt das, man hat sich darauf geeinigt, den ukrainischen Führer gemeinsam in die Mangel zu nehmen. Die Möglichkeit dafür ist angesichts der schon länger bestehenden inoffiziellen Direktkontakte zwischen Trump und Putin durchaus gegeben.“
Auf einzelne Forderungen könnte Kyjw eingehen
Der Ukraine-Korrespondent der taz, Bernhard Clasen, begrüßt, dass die ukrainische Regierung bereit ist, nach Istanbul zu reisen:
„[S]ie ist damit in mehrerlei Hinsicht über ihren eigenen Schatten gesprungen. Nun gibt es russische Forderungen, auf die die Ukraine nicht eingehen kann: Sie kann nicht, wie von Russland gefordert, einfach Städte wie beispielsweise Saporischschja den Russen schenken. Die Forderung Russlands hingegen, die Diskriminierung der russischen Sprache in der Ukraine zu beenden, verdient durchaus Beachtung. Es kann nicht sein, dass, wie im April in Kyjiw geschehen, Teenager zum Inlandsgeheimdienst SBU vorgeladen werden, nur weil sie auf der Straße russischsprachige Musik gehört haben.“
Nun ist der Kreml am Zug
Doschd-Chefredakteur Tichon Dsjadko beschreibt in einem von Echo übernommenen Telegram-Post ein diplomatisches Duell:
„Putin schlägt nächtens Verhandlungen vor und stand in Trumps Augen als Friedensstifter da, aber Selenskyj erhöht den Einsatz: Er sagt, er sei bereit, mit Putin zu verhandeln – schon ist er in Trumps Augen der Friedensstifter. Moskau will das nicht und plant, jemand wie [Ex-Kulturminister] Medinski oder Sluzki [Chef der Systemoppositionspartei LDPR] hinzuschicken, was einem Scheitern der Gespräche gleichkäme. Aber prompt besteht Trump auf Verhandlungen – nun kann Kiew schwer auf Verhandlungen mit Putin persönlich pochen. Doch dann legt Trump nach und sagt, er werde selbst nach Istanbul fliegen – nun kann Moskau keine Clowns schicken. ... Der Kreml ist am Zug.“
Ein unangenehmes Ultimatum
Avvenire ist gespannt:
„Wenn der Kremlchef tatsächlich zu seinem schwierigen Freund Erdoğan fliegt, um dem, wie er es nennt, 'Chef der Kiewer Nazis' gegenüberzusitzen (und man muss das bis zum letzten Moment bezweifeln), dann hat sich nach mehr als drei Jahren heftiger Auseinandersetzungen wirklich etwas geändert. Der russische Präsident mag keine Ultimaten – und Europa, das, vielleicht auch dank des neuen deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz, wieder an Kompaktheit und Entschlossenheit gewonnen hat, hat ihm eines gestellt.“
Lieber handfeste Sanktionen als leere Worte
Eesti Päevaleht fordert eine konsequente Umsetzung der von Starmer, Macron, Merz und Tusk am Samstag angedrohten "massiven Sanktionen":
„Es gibt keine Anzeichen für eine Waffenruhe, die ja auch ein Ja aus Russland benötigt. ... Es ist an der Zeit zu zeigen, dass die Sanktionen, die paketweise gegen Russland verhängt wurden, wobei hart daran gearbeitet wurde, dass es genügend Schlupflöcher und Ausnahmen gibt, auf eine ganz neue Ebene gehoben werden können. ... Der Kreml hat schon genug über uns und unsere Sanktionen gelacht. Die Spielchen müssen endlich aufhören. Es geht nicht nur um den Frieden, sondern auch um die Glaubwürdigkeit des Westens in dem ganzen Prozess – und um das Leben Tausender unschuldiger Ukrainer.“
Schrittweise Rückkehr der Diplomatie
Le Figaro zieht drei Lehren:
„Erstens: Die Diplomatie kommt in Gang – vielleicht nur langsam, aber es ist eine Entwicklung, die es zu unterstützen gilt. Zweitens: Die Europäer kehren ins Spiel zurück – begünstigt durch Trumps Scheitern und seinem Versuch, sich von der Ukraine abzuwenden. Das überträgt ihnen eine große Verantwortung, um Kyjiw zu unterstützen und gleichzeitig wieder ein akzeptabler Gesprächspartner für Moskau zu werden. Drittens: Die amerikanische Kehrtwende ist bemerkenswert, aber sie bleibt in diesem Stadium vor allem taktisch und stellt Trumps strategisches Ziel einer Aussöhnung mit Putin nicht infrage.“
Ein Buhlen um Trumps Gunst
Politologe Wolodymyr Fessenko analysiert auf Facebook:
„Selenskyjs Ansage, er werde am 15. Mai in der Türkei persönlich auf den Kremlchef Wladimir Putin warten, ist die Fortsetzung eines rege betriebenen taktischen Spiels rund um das Thema Friedensgespräche. Es geht nicht um Verhandlungen, sondern um die Bereitschaft zu Verhandlungen. Formal ist es ein Appell an Putin, doch tatsächlich handelt es sich um ein Signal an den Hauptschiedsrichter aus Washington – an US-Präsident Donald Trump. Auch Putins Erklärung mit dem Angebot zu Verhandlungen in Istanbul ist im Grunde ebenfalls für Trump gedacht.“
Russland beharrt auf alten Forderungen
Dagens Nyheter ist pessimistisch:
„Es ist bezeichnend, dass Putin zwar behauptet, er schlage in Istanbul bedingungslose Verhandlungen vor, diese aber in Wirklichkeit an zahlreiche Bedingungen geknüpft sind: Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow sagt, die Gespräche sollten sich an den Verhandlungen orientieren, die im Frühjahr 2022 in Istanbul stattfanden, wo Russland unter anderem die ukrainische Neutralität und strenge Beschränkungen für die ukrainischen Verteidigungskräfte forderte. Moskau verlangt außerdem, dass die 'Ursachen des Krieges' angegangen werden. Damit will der Kreml zum Ausdruck bringen, dass die Nato-Erweiterung die Schuld am russischen Angriffskrieg trägt.“
Putin kaschiert sein Einlenken
Politologe Abbas Galliamow erklärt auf Facebook, warum Moskau Verhandlungen anbietet:
„Manche schreiben jetzt, Putin habe 'den von der Ukraine angebotenen Waffenstillstand abgelehnt'. Wie haben sie sich das denn vorgestellt? Dass Putin sich hinstellt und sagt: 'Ich akzeptiere Selenskyjs Vorschlag?' Kein Politiker würde so etwas tun. In der Politik darf man nicht den Zweitbesten spielen. ... Man muss den Vorschlag des Gegners ignorieren und einen eigenen – leicht abgewandelten – Vorschlag vorlegen, der originell aussieht und nicht wie eine Kopie des gegnerischen Vorschlags. Das sind Grundregeln der öffentlichen Politik, und Putin kennt sie. Dennoch musste Russlands Präsident faktisch dem Vorschlag von Selenskyj zustimmen. Denn der wurde von Trump unterstützt.“
Nicht nur an die kommenden Monate denken
Auf langfristiges Denken pocht Naftemporiki:
„Die europäischen Politiker müssen an der Ausarbeitung eines kohärenten Plans für einen dauerhaften Frieden in Europa arbeiten, der nicht nur die Zukunft der Ukraine, sondern auch die Sicherheit des gesamten Alten Kontinents sowie die Stellung Russlands beeinflussen wird. Denn wenn der Friedensprozess irgendwann abgeschlossen ist, zum Guten oder zum Schlechten, wird Russland geografisch immer noch dort sein, wo es heute ist. Dasselbe gilt für Europa.“